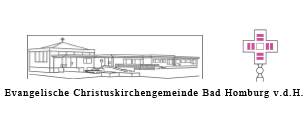Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde viel über die Menschen geschrieben und geredet, die in medizinischen Berufen aktiv sind. Es wurde geklatscht und gelobt. „Wir waren aber schon vor Corona systemrelevant!“, sagt Ingrid Rochlus, Vorsitzende der Ökumenischen Sozialstation Bad Homburg. Und das mittlerweile schon seit Jahrzehnten. Vor 40 Jahren fanden sich die Stadt und die Kirchengemeinden zusammen, um die „Pflege daheim“ zu verbessern. Was vorher den einzelnen Gemeindeschwestern oblag, wurde nun zentral organisiert.
Viel hat sich seitdem verändert. Mittlerweile sind 29 Mitarbeiter aktiv, derzeit lernen zudem vier Auszubildende das Pflege-Handwerk in dem von der IHK zertifizierten Ausbildungsbetrieb. Ehrenamtliche unterstützen die Arbeit der Sozialstation, unter anderem beim Engagement für an Demenz erkrankte Menschen – ein Zukunftsthema, wie Rochlus anmerkt.
Doch längst steht die Diakonie im Wettbewerb, zahlreiche ambulante Pflegedienste sind am Markt aktiv, einige von Hilfsorganisationen, andere komplett privatwirtschaftlich organisiert.
Geblieben ist der „diakonische Gedanke“ – der Anspruch, sich bei Bedarf auch mal mehr Zeit für die Klienten zu nehmen, auch wenn die Krankenkassen die Kosten dafür nicht übernehmen. Als Pflegedienst mit christlichem Leitbild und den entsprechenden Werten gelte es, den „Dreiklang aus Mitmenschlichkeit, Pflegetechnik und Wirtschaftlichkeit“ zu schaffen – kein leichtes Unterfangen angesichts des Kostendrucks in der Branche.
Gedanken über die Zukunft
Entsprechend macht sich Rochlus Gedanken über die Zukunft. „Man erwartet von der Pflege, dass sie spart. Natürlich schauen wir, wo wir effektiver werden können. Aber am Personal werde ich sicher nicht sparen.“ Ebenso wenig soll am Diakonischen Gedanken gerüttelt werden. „Aber ich möchte, dass wir der Pflegedienst für Bad Homburg bleiben!“, so Rochlus. Auch die Zukunft der Pflege liege im ambulanten Bereich.
Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) übergab jetzt einen neuen Wagen, mit dem künftig eine Mitarbeiterin zu den rund 500 Pflegeberatungen fahren soll, bei denen die Klienten erfahren, welche Möglichkeiten es für sie in der Pflege, bei Hilfsmitteln, der Betreuung oder der Entlastung der pflegenden Angehörigen gibt. Die Mitarbeiterin kümmert sich zudem darum, einen möglichen Übergang von Klienten vom Krankenhaus nach Hause zu begleiten und möglichst gut zu gestalten. Rochlus wünscht sich, dass von Ehrenamtlichen auch der andere Weg begleitet werden könnte. „Wenn jemand in der Notaufnahme ist, der dem Patienten zur Seite steht, für ihn da ist oder darauf achtet, dass zum Beispiel die Brille dabei bleibt …“
Wolfgang Blum, Vorsitzender zahlreicher Stiftungen und seit Beginn einer der Förderer der Sozialstation, steuerte ein E-Bike zur Geburtstagsfeier bei. Damit sollen vor allem die zahlreichen Visitationen abgewickelt werden, bei denen vor allem geschaut wird, wie es dem Pflegebedürftigen geht – für die Pflegetouren, die bei Wind und Wetter und mit ausreichend Material über die Bühne gebracht werden müssen, ist das Rad nicht vorgesehen. Allerdings schließt das Team nichts aus, da man nun zunächst Erfahrungen sammeln wolle.
Rochlus, die die Sozialstation seit zehn Jahren ehrenamtlich führt, bedankte sich für die Förderung, nutzte die Gelegenheit aber auch, um für mehr zu werben. Man müsse sich, wolle man am Markt bestehen, ein Stück weit vergrößern. An Hetjes gewandt sagte sie: „Wir vermissen Sie seit 2013 sehr“, und spielte damit darauf an, dass die städtische Förderung von 80.000 Euro jährlich seitdem nicht mehr fließe. Dabei sei die Stadt 1980 federführend dabei gewesen, um ihren Bürgern eine gute Pflege außerhalb von Krankenhaus und Heim zu ermöglichen. So sei das Auto ein „guter Anfang“, dem OB wünschte sie – charmant, aber deutlich – „viele schlaflose Nächte, in denen Sie überlegen, wie wir an weitere Mittel kommen“. Man leiste viel, was andere nicht übernehmen würden. „Wir fahren Touren, die wir nicht finanzieren können.“ Rochlus vertritt denn auch die Auffassung: „Ein ambulanter Pflegedienst sollte keinen Gewinn machen.“
Hetjes betonte, dass man nicht mehr pauschal, sondern nur projektbezogen bezuschussen dürfe – „das EU-Beihilferecht ist ein scharfes Schwert, der Staat darf nicht im privaten Sektor fischen“. Bei Projekten werde man sich weiter beteiligen.
So sei man dankbar dafür, dass sich viele Stifter und Privatpersonen wie Wolfgang Blum so engagierten.
So erschienen in der Taunuszeitung am 11. Juli 2020 – Ein Bericht von HARALD KONOPATZKI

Zwei neue Fahrzeuge helfen dem Team der Ökumenischen Sozialstation. Marion Börner-Balk {v. li.} präsentiert das E-Bike, lnes Wenzel das neue Auto.
Die Vorsitzende Ingrid Rochlus freut sich über das Engagement der Stadt und des umtriebigen Stiftungsvorsitzenden Wolfgang Blum.